BeeWiki
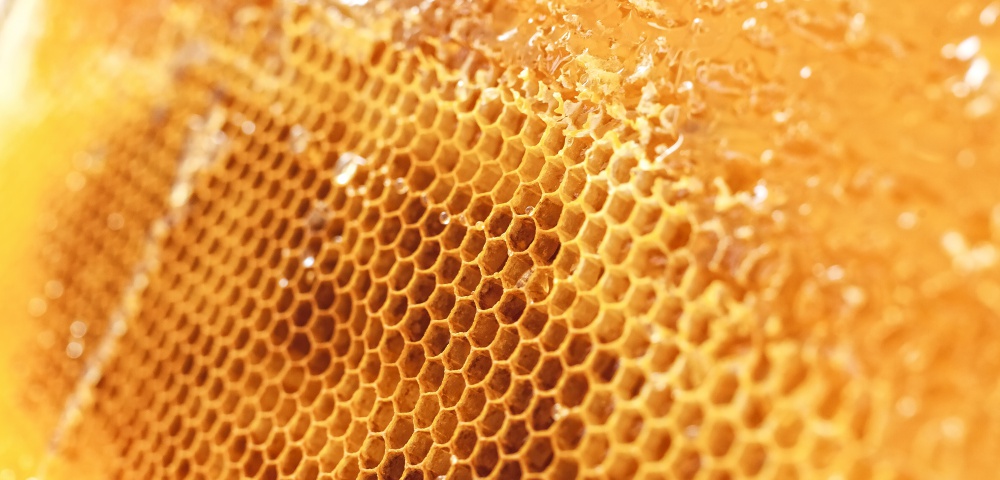
Auf Märkten erhielt man für einen Topf Bienenhonig häufig einen Esel oder ein Rind. Ramses der 2. soll seine Bediensteten mit Honig bezahlt haben.

Beim Schwänzeltanz schwänzelt die Biene eine gerade Linie, d.h. sie wackelt dabei mit ihrem Hinterleib. Diesen Tanz wiederholt sie weitere Male. Die Entfernung zum Ziel drückt die Biene mit der Dauer ihres Tanzes aus. Je weiter die Entfernung der Futterquelle zum Bienenstock, desto länger der Ablauf des Schwänzeltanzes. Die Richtung zum Fundort gibt die Biene mit der Tanzrichtung an – sie steht immer im Verhältnis zur Sonne. Schwänzelt die Biene an der Wabe ihre gerade Linie senkrecht von unten nach oben, liegt die Futterquelle auf dem direkten Weg vom Bienenstock in Richtung der Sonne. Eine Rotation des Schwänzeltanzes um einen bestimmten Winkel steht für die Flugrichtung mit dem Winkel α rechts oder links der Sonne.

Der Rundtanz wird von der Biene aufgeführt, wenn die Futterquelle bis zu ca. 100 Meter vom Bienenstock entfernt ist. Dabei wird nicht der genaue Ort des Futters angegeben, sondern lediglich, dass sich Futter im näheren Umkreis des Bienenstocks befindet. Der Tanz wird aufrecht an den Waben vollführt. Die Biene läuft bis zu drei Minuten in einem kleinen Kreis umher. Nach einer Umdrehung ändert sie dann ihre Richtung. Mit ihrem Tanz bekommt sie die Aufmerksamkeit von Sammlerinnen. Diese laufen der tanzenden Biene nach und nehmen dabei den Duft der besuchten Pflanze wahr. Danach machen sich die Sammlerinnen auf den Weg, wobei sie sich am mitgeteilten Duft orientieren und das Ziel ausfindig machen.

Bienen verfügen über keine Wortsprache wie Menschen. Dennoch kommunizieren sie mit ihren Artgenossen, z. B. wenn sie eine Futterquelle gefunden haben und die anderen Bienen über den Fundort informieren wollen. Dies geschieht über spezielle Bewegungsabläufe, die mit Bedeutungen verbunden sind. Diese Art der Kommunikation wird Tanzsprache genannt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Tänzen, die die Kundschafterbienen vollziehen, um sich den Sammlerinnen mitzuteilen: den Rundtanz und den Schwänzeltanz.

Honig enthält wichtige Antioxidantien, reguliert die Cholesterinwerte und trägt zudem zur Wundheilung bei. Auch bei Magen-Darm-Problemen, Erkältungen und Husten kann Honig die Beschwerden lindern. Honig wirkt verdauungsfördernd und reguliert mithilfe von Mineralsalzen den Mineralstoffwechsel. Den Aufbau von Knochen und Zähnen unterstützt das flüssige Gold dank seiner Phosphorverbindungen. Zur Blutbildung tragen Eisen, Mangan, Chlor bei.

Pflanzen Sie, worauf Bienen "fliegen": Bienen mögen nektar- und pollenreiche Pflanzen. Achten Sie darauf, ungefüllt blühende Blumen zu verwenden. Legen Sie doch anstelle eines grünen Ziergartens eine artenreiche Blumen- und Kräuterwiese an oder nutzen Sie blühende Hecken für Ihre Grundstücksbegrenzung.

Jeder Deutsche verzehrt jährlich rund 1,1 kg Honig. Damit decken die heimischen Bienen nur 20 % des gesamten Honigbedarfs ab.

Auf ihrem Sammelflug besucht eine Biene zunächst viele Blüten, um Nektar aufzunehmen. Um ein einziges Mal ihren Honigmagen zu füllen, der etwa 0,05 Gramm Volumen hat, braucht sie 1.000 bis 1.500 Blüten. Dann kehrt sie mit vollem Honigmagen in ihren Stock zurück und übergibt die noch sehr wässrige Substanz an eine Stockbiene. Die Sammelbiene macht sich sogleich wieder auf den Weg zur Nahrungsquelle. Im Frühling und Sommer ist sie bei gutem Wetter von Tagesanbruch bis kurz vor der Dämmerung unterwegs. Aus etwa 2 bis 2,5 Kilo Nektar wird nach dem Trocknungs- und Veredelungsprozess ein Pfund Honig. Nektar hat – je nach Pflanzenart – einen Wassergehalt von bis zu 90 %, der verdeckelte reife Honig dagegen nur zwischen 15 und 20 %.

Die Bestäubung von Nutzpflanzen durch Bienen erhöht allerdings nicht nur den Ertrag, sondern verbessert auch die Qualität der Früchte.

Reiner Blütenhonig enthält meist viel Traubenzucker (Glukose). Eine Ausnahme bildet der Robinienhonig (Akazienhonig). Blütenhonig kristallisiert aufgrund des hohen Traubenzucker-Anteils relativ schnell und kommt in fester bis cremiger Konsistenz in den Handel.

Rapshonig ist der häufigste Sortenhonig in Deutschland. Er gehört zum Typ des Blütenhonigs, da er ausschließlich aus Nektar entsteht.

Raps (Brassica napus) wird als Wildform durch Insekten bestäubt. Erst der dichte, flächige Anbau gibt die Voraussetzungen für eine Bestäubung durch den Wind. Aus ökonomischer Sicht ist es sinnvoll, die Windbestäubung durch eine gezielte Bestäubung durch Honigbienen zu optimieren. Der Ertrag steigt durch einen höheren Fruchtansatz, eine kürzere Blühperiode und damit ein gleichmäßigeres Abreifen der Früchte (Ölsamen). Die Ernteverluste bedingt durch einen inhomogenen Reifegrad werden verringert.

Die Bienenköniginen ist nach 16 Tagen reif, die Arbeiterinnen nach 21 Tagen und die Drohnen nach 24 Tagen.

Als junge Biene bleibt die Arbeiterin zunächst bis zu drei Wochen im Stock, putzt die Zellen, nimmt den Sammelbienen Nektar und Pollen ab, füttert damit Alt- und Jungmaden, baut neue Waben aus Wachs, reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Stock und wird schließlich zur Wachbiene am Stockeingang. Erst in der zweiten Lebenshälfte ist sie vorrangig Sammelbiene im Außendienst, sucht die Umgebung nach Nektar, Blütenstaub (Pollen) und Wasser ab und versorgt so die Daheimgebliebenen mit allen lebenserhaltenden Köstlichkeiten.

Die männlichen Tiere, die Drohnen, leben nur wenige Wochen. Ihre Lebensaufgabe ist es, die Königin auf ihrem Hochzeitsflug zu begatten. Dies bedeutet für die Drohnen meistens den Tod. Sollten sie sich diesem Schicksal allerdings entziehen, werden sie kurze Zeit später von den Arbeiterinnen aus dem Bienenstock vertrieben.

Die Bienenkönigin kommt in jedem Volk nur ein Mal vor. Ihre Lebenserwartung beträgt bis zu fünf Jahre. In dieser Zeit sorgt sie als einziges geschlechtsreifes Weibchen für Nachkommen und steuert das Bienenvolk durch eine physiologische Droge, die Königinnensubstanz. Aus den befruchteten Eiern entwickeln sich die Arbeiterinnen, aus den unbefruchteten schlüpfen die Drohnen.

Ein Bienenstaat besteht aus Drohnen, einer Königin und Arbeiterinnen. Im Bienenstock gibt es eine klare Arbeitsverteilung für jeden der drei Bienentypen. Die Mehrheit der im Volk lebenden Bienen bilden die fleißigen Arbeiterinnen.

Ein Bienenvolk funktioniert als gemeinschaftlicher Organismus, in dem verschiedene Aufgabenbereiche perfekt durchorganisiert und aufeinander abgestimmt sind.

Oft hört man den Begriff "Wildbienen". Jede Biene, außer der Honigbiene, ist eine Wildbiene. Es gibt nur circa 10 Bienenarten, die zu den Honigbienen gehören. Alle anderen über 20.000 Bienenarten sind somit Wildbienen.Die meisten Bienenarten haben andere Farben als unsere Honigbienen. Auch die Hummeln gehören zu den Bienen. Die Mehrzahl der Arten lebt alleine, also nicht in Gruppen oder gar Staaten. Andere Arten sind sogenannte Kuckucksbienen. Sie legen ihre Eier heimlich in die Nester von anderen Bienenarten. Viele der Kuckucksbienen gehören zu den sogenannten Wespenbienen, die man nicht mit den Wespen verwechseln sollte.

Dass Bienen schon in Urzeiten existiert haben, bestätigt der Fund einer in Bernstein eingeschlossenen Biene aus dieser Zeit. Es wird allerdings angenommen, dass auch schon vor über 100 Millionen Jahren Bienen existiert haben.

Die ökologische wie ökonomische Bedeutung der Biene ist nicht zu unterschätzen: Ohne ihre Fremdbestäubung sinken die landwirtschaftlichen Erträge. Volkswirtschaftlich bemessen leistet sie durch ihre Arbeit einen Beitrag, der 70 Milliarden € entspricht.

Heute ist die Honigbiene bei uns nach Rind und Schwein das drittwichtigste Nutztier. Ihre Bestäubungsleistung sichert uns die Vielfalt an Nahrungsmitteln, wie wir sie kennen und genießen. Die Honigbiene ist also hauptverantwortlich für gute Ernten und ökologische Artenvielfalt.

